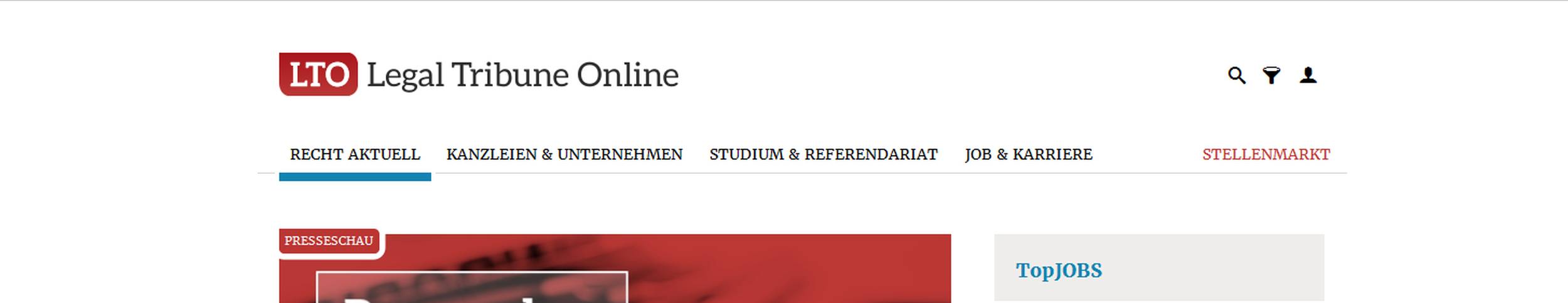Unmittelbar nachdem hier der aktuelle Beschluss des Verwaltungsgerichts Aachen zur Zuständigkeit des Amtsarztes am Wohnort des Beamten bei Untersuchungen zur Dienstfähigkeit erstritten wurde, ist nun ein schon etwas älterer Beschluss der Verwaltungskammer beim Kirchengericht der Ev. Kirche in Deutschland bekannt geworden. Er verhält sich hierzu geradezu widersprüchlich.
Nach unserer rechtlichen Bewertung ergibt nämlich die Normenkette, dass auch im Kirchenbeamtenrecht der Ev. Kirche im Rheinland das staatliche nordrhein-westfälische Landesrecht Anwendung findet. Das Verfahren zur Untersuchung der Dienstfähigkeit bestimmt sich nach dem Kirchenbeamtengesetz (KBG.EKD), sowie nach landeskirchlichem Recht. Gem. § 11 Abs. 1 S. 1 AG.KBG.EKD gilt:
„Ergänzend zu den Bestimmungen des Kirchenbeamtengesetzes der EKD und dieses Kirchengesetzes ist das für die Beamtinnen und Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen jeweils geltende Recht sinngemäß anzuwenden, soweit das kirchliche Recht nichts anderes bestimmt.“
Das nordrhein-westfälische Beamtenrecht bestimmt in § 19 Abs. 2 ÖGDG NRW:
„Für die amtlichen Untersuchungen zur Ausstellung von gutachterlichen Stellungnahmen in beamtenrechtlichen Verfahren nach dem Landesbeamtengesetz NRW ist die untere Gesundheitsbehörde am Wohnort der zu begutachtenden Person zuständig. Abweichend davon kann die Behörde oder Einrichtung, die das beamtenrechtliche Verfahren durchführt, die untere Gesundheitsbehörde am Dienstort der zu begutachtenden Person beauftragen.“
Dann gilt aber auch der oben erwähnte Grundsatz, den das Verwaltungsgericht Aachen bestätigt hat, dass für die Untersuchung der Dienstfähigkeit des Kirchenbeamten ausschließlich der Amtsarzt am Wohnort des Kirchenbeamten zuständig wäre.
Die Ev. Kirche im Rheinland vertritt hierzu eine abweichende Rechtsposition und ist der Auffassung, dass der nachfolgende Beschluss der Verwaltungskammer ihre Praxis stützt. Denn dort hat die Verwaltungskammer die aufschiebende Wirkung eines Widerspruchs gegen die Aufforderung zur Untersuchung bei einem 250km (!) entfernten Vertrauensarzt nicht wiederhergestellt. Die Verwaltungskammer hat insbesondere vor dem Hintergrund, dass ein „Fahrservice“ des Dienstherrn angeboten wurde, die An- und Abreise nicht für unzumutbar gehalten.
Aus unserer anwaltlichen Sicht ist eine derartige Prüfung der Zumutbarkeit (der Verhältnismäßigkeit) schon systematisch nicht notwendig, weil eben das landeskirchliche Recht sich ganz auf den staatlichen Gesetzgeber in NRW fokussiert hat. Dieser kennt die Untersuchung bei einem entfernten Vertrauensarzt nicht, sondern ausschließlich die Untersuchung beim Amtsarzt vor Ort. Es bleibt also abzuwarten, ob die Verwaltungskammer auch in zukünftigen Verfahren ihre Rechtsprechung aus dem Jahr 2016 aufrecht erhalten wird.
Der Beschluss lautet im Volltext: „nur 250km bis zum Vertrauensarzt?, Verwaltungskammer bei dem Kirchengericht der EKD, Beschluss v. 08.11.2016, Az. 0136/B17-2016“ weiterlesen