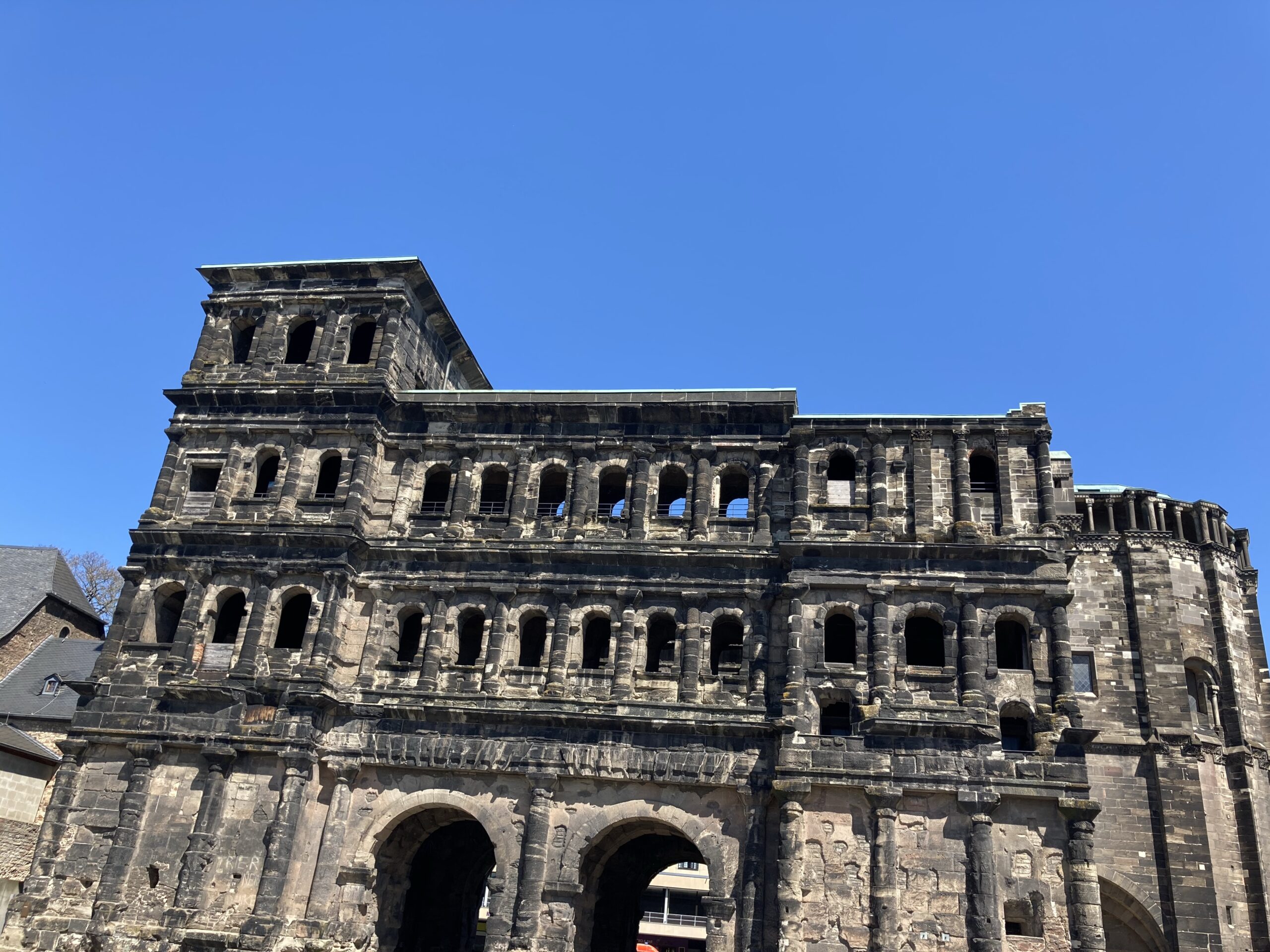In der staatlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit findet seit vielen Jahren schon der „Streitwertkatalog für die Verwaltungsgerichtsbarkeit“ Anwendung. Er wurde zuletzt in der Fassung der der am 21. Februar 2025 beschlossenen Änderungen veröffentlicht.
Mit dem Katalog werden – soweit nicht auf gesetzliche Bestimmungen hingewiesen wird – Empfehlungen ausgesprochen, denen das Gericht bei der Festsetzung des Streitwertes bzw. des Wertes der anwaltlichen Tätigkeit (§ 33 Abs. 1 RVG) aus eigenem Ermessen folgt oder nicht. Das bedeutet im Klartext: Abweichungen sind jedem Gericht jederzeit möglich.
Gleichzeitig bietet der Katalog aber auch die Gewähr dafür, dass der Rechtsuchende mit einer gewissen Verlässlichkeit seine prozessualen und finanziellen Chancen und Risiken einschätzen und kalkulieren kann.
Ein Gegenstück für die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit der ev. Kirche fehlt. Es ist aber aus unserer anwaltlichen Sicht dringend erforderlich, weil kirchliche Rechtsprechung sich zum Teil grundsätzlich von staatlicher Rechtsprechung löst (so etwa im kirchlichen Disziplinarrecht) oder weil Gegenstände des Kirchenrechts (wie etwa der Wartestand) im staatlichen Recht nicht entschieden worden sind.
Die kirchlichen Gerichte sind ehrenamtlich organisiert, sie sind mit Volljurist:innen und – je nach Prozessordnung – auch ergänzend mit Pfarrer:innen oder mit Laien besetzt. Die Kirche hat sich im Laufe der Zeit ein immer stärkeres Vorbild am staatlichen Prozessrecht genommen.
Gleichwohl verweigern die Kirchengerichte die Übernahme staatlicher Gerichtspraxis im Hinblick auf Streit- und Gegenstandswerte, sowie die Kostenerstattungsverfahren. (ausführlich: Hotstegs, „Mein Gott!“ – Kosten und Kostenerstattung vor Kirchengerichten, ZAP 2018, 583)
Die im Mandat geschuldete Prognose der Verfahrenskosten ist so seriös im Vorhinein nicht möglich.
(Nur am Rande: gleiches gilt auch für Gerichtskosten.)
Bleiben schließlich zwei Probleme für die im Kirchenrecht beratenen Rechtsanwält:innen: unberechenbare Streitwerte und überlange Verfahren.
Wir haben daher eine – naturgemäß unvollständige – Liste aufgestellt, in der wir aus unserer anwaltlichen Sicht wesentliche Entscheidungen zum Gegenstandswert bzw. Streitwert zusammengestellt haben. Die Tabelle stellt den Streitwertkatalog der staatlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 der kirchengerichtlichen Rechtsprechung gegenüber. Die Aktualisierung auf den Streitwertkatalog 2025 steht noch aus. Wir sind bemüht, diese Datenbank regelmäßig zu erweitern, zu ergänzen und zu aktualisieren. Bitte wenden Sie sich bei Fragen, Vorschlägen und auch gerne zur Einsendung eigener Streitwertentscheidungen direkt an Rechtsanwalt Robert Hotstegs.
Stand der Bearbeitung: 30.09.2025
„Streitwertkatalog der kirchlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit“ weiterlesen